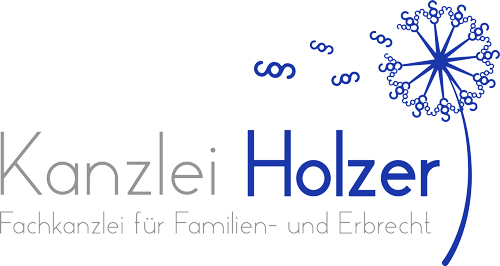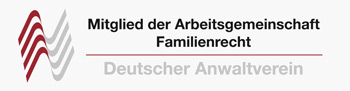Beispiel: Ein Ehemann mit zwei Töchtern und einem Sohn verfügt in einem Einzeltestament, dass lediglich der Sohn sein alleiniger Erbe sein soll; die Ehefrau und die beiden Töchter werden also enterbt.
Wie beurteilt die deutsche Rechtsprechung eine diskriminierende Erbeinsetzung?
In Deutschland hat der Bundesgerichtshof im Jahre 1998 entschieden, dass die Ungleichbehandlung von weiblichen Familienmitgliedern „Ausdruck der Testierfreiheit des Erblassers“ sei und deren Grenzen nicht überschreite. Für letztwillige Verfügungen des Erblassers gelte der Grundsatz des Diskriminierungsverbots gerade nicht (BGH, Beschluss vom 2. Dezember 1998 – IV ZB 19/97 –, BGHZ 140, 118-134, Rn. 41).
Fraglich ist, ob dieses Verständnis der Testierfreiheit noch zeitgemäß ist. Die mit dem Testament verbundene geschlechtsbezogene Diskriminierung kann ohne weiteres unter den Begriff „Sexismus“ subsumiert werden. Sexismus ist ein unbestimmter Begriff, der gleichzeitig Assoziationen in viele Richtungen erzeugt und mehrdimensional ist. Gemeinsam in den Bestimmungen von Sexismus ist die Herabwürdigung der konkreten Person in ihrer Geschlechtsidentität, die Objektivierung und Instrumentalisierung eines Subjekts, dem Würde und Souveränität genommen werden (vgl. hierzu die Zusammenfassung der Pilotstudie „Sexismus im Alltag“, hrsg. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: https://www.bmfsfj.de/resource/blob/141246/6e1f0de0d740c8028e3fed6cfb8510fd/sexismus-im-alltag-pilotstudie-data.pdf)
Im Nachbarland Österreich jedenfalls wurde bereits im Jahre 2019 vom Obersten Gerichtshof (OGH) entschieden, dass Geschlechterklauseln in letztwilligen Verfügungen sittenwidrig und damit unzulässig und nichtig sind (OGH Wien, Urt. v. 24.1.2019 – 6 Ob 55/18h, NZG 2019, 904). Da der OGH in seiner Entscheidung vielfach auf deutsche Judikatur und Literatur zurückgreift, wurde in der deutschen Fachliteratur vertreten, dass die Entscheidung des OGH auch für das deutsche Recht von Relevanz sei (Anmerkung Kalss, NZG 2019, 904). Dieser Effekt ist bislang nicht eingetreten. Dies gilt auch im Beispielsfall. Das zuständige Oberlandesgericht Hamm hielt die Enterbung aller weiblichen Familienmitglieder allein mit einem kurzen Hinweis auf die „Testierfreiheit des Erblassers“ für zulässig (OLG Hamm, Beschluss vom 12.01.2024 – I-10 W 126/23 – nicht veröffentlicht).
Wie beurteilt der EuGHMR eine diskriminierende Erbeinsetzung?
Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EuGHMR) hat der Staat auch bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um Diskriminierungen zwischen Privatpersonen zu verhindern und zu sanktionieren; insbesondere hat er für einen effektiven Rechtsschutz gegen Diskriminierung zu sorgen. In dem der Entscheidung vom 05.07.2022 zugrunde liegenden Sachverhalt ging es um eine Stiftung von Todes wegen nach türkischem Recht, die im Jahr 1536 – also zur Blütezeit des Osmanischen Reiches errichtet wurde; als sog. Annexstiftung besteht sie unter dem heutigen Stiftungsrecht der Türkei fort. Im Stiftungsgeschäft hatte der Stifter angeordnet, dass die nach vorrangigen Verwendungszwecken verbleibenden Erträge des Stiftungsvermögens zunächst zu einer Art Mindestunterhalt für die Töchter männlicher Abkömmlinge eingesetzt werden sollen und der dann verbleibende Rest schließlich zur gleichmäßigen Verteilung unter den männlichen Abkömmlingen. Der EuGHMR bejaht eine Diskriminierung und sieht darin einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot nach Art. 14 EMRK i. V. mit Art. 1 EMRK-Zusatzprotokoll, den die Kinder der Betroffenen als indirekte Opfer geltend machen konnten. Weibliche Abkömmlinge würden nicht dadurch gleichermaßen berücksichtigt oder sogar bevorzugt, dass ihnen ein vorrangiger „Mindestunterhalt“ zukommt, da Letzterer im konkreten Fall gerade einmal 3.600 Euro betrug, während die jährlichen Stiftungserträge in Millionenhöhe auf eine deutlich höhere Teilhabe der männlichen Letztbegünstigten schließen lassen (EuGHMR, Entscheidung vom 05.07.2022 – ECLI:CE:ECHR:2022: 0705JUD007013316 – FamRZ 2023, 861-863).
„Geschlechterklausel“: offene Diskriminierung
Der Beispielsfall und der vom EuGHMR entschiedene Fall unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt: Während der EuGHMR eine explizit angeordnete Klausel zu beurteilen hatte, in der „offen“ zwischen weiblichen und männlichen Nachfahren differenziert wurde, kann im Beispielsfall nur vom Ergebnis her – also „verdeckt“ – auf eine Diskriminierungsabsicht geschlossen werden.
Beinhaltet das Testament eine offene „Geschlechterklausel“ bestehen nach der Rechtsprechung des EuGHMR gute Chancen, um das Testament erfolgreich anzufechten. Eine „Geschlechterklausel“ liegt vor, wenn der Erblasser im Rahmen seiner letztwilligen Verfügungen eine offene Differenzierung zwischen den Mitgliedern einer bestimmten Personengruppe vornimmt und das maßgebliche Differenzierungskriterium das Geschlecht der Personen ist. Der Erblasser unterwirft die Gruppenmitglieder eines Geschlechts einer bestimmten letztwilligen Regelung und die Gruppenmitglieder des anderen Geschlechts einer anderen letztwilligen Regelung (vgl. zur „Geschlechterklausel“: Christoph Klampfl: „Geschlechterklauseln in letztwilligen Verfügungen – rechtmäßige Ausübung der Testierfreiheit oder sittenwidrige Diskriminierung?“, in: JEV 2016, 178 ff.).
Kann ein Testament mit einer „verdeckten Diskriminierung“ erfolgreich angefochten werden?
Es gibt Fälle, in denen sich die Diskrimimierungsabsicht des Erblassers nicht anhand der testamentarischen Anordnung offen nachweisen lässt, da die Diskriminierung nur „verdeckt“ als Ergebnis der Erbeinsetzung zum Ausdruck kommt. Ob in diesen Fällen eine Chance für eine erfolgreiche Anfechtung besteht, lässt sich mangels klarer gesetzlicher Vorgaben derzeit nicht eindeutig beantworten. Soweit die Frage der Rechtsprechung überlassen bleibt, kommt es auf den konkreten Einzelfall an.
Es ist anerkannt, dass eine Einschränkung der Testierfreiheit durch § 138 Abs. 1 BGB ausnahmsweise dann in Betracht kommt, wenn das Verdikt der Sittenwidrigkeit, sich auf eine klare, deutlich umrissene Wertung des Gesetzgebers oder allgemeine Rechtsauffassung stützen kann (BGH NJW 1994, S. 248, 250 zu III 2 c; BayObLG NJW 98, 2369; OLG Braunschweig Urt. v. 4.11.1999 – 2 U 29/99). Auch das BVerfG hat deutlich gemacht, dass sich das Erbrecht im Einklang mit allen anderen Verfassungsnormen halten muss, insbesondere dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG (vgl. BVerfG, NJW 1971, 2163; NJW 1980, 985).
Falls Sie rechtliche Unterstützung bei der Anfechtung eines Testaments benötigen oder Fragen zu den rechtlichen Aspekten haben, steht Ihnen Notar und Rechtsanwalt Ulrich Holzer in Bocholt zur Verfügung. Profitieren Sie von seiner umfassenden Erfahrung, um Ihre Erfolgsaussichten bei der Anfechtung eines Testaments zu prüfen.